
Das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) hat heute einen Entscheid (PDF) zu einer strittigen Fallpauschale für akutstationäre Spitalbehandlungen veröffentlicht.
Es ist der erste Entscheid seit Einführung des neuen gesamtschweizerischen Abrechnungssystems SwissDRG im Jahr 2012. Die von der Luzerner Regierung für das eigene Kantonsspital festgesetzte Fallpauschale von Fr. 10‘325.- (auch Baserate genannt) zu Lasten obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) wurde aufgehoben und zum Neuentscheid an den Regierungsrat zurückgewiesen.
Ich hatte zu dieser Baserate im Jahr 2012 eine Tarifempfehlung abgegeben, welche auf einen Betrag von Fr. 8974.- pro Fall lautete (bei einer Fallschwere von 1.0).
Als Preisüberwacher lese ich den Entscheid in Teilen klar positiv: Der neue Grundsatzentscheid bestätigt das zweistufige Preisprüfungsmodell des Preisüberwaches, bestehend aus einer kostenbasierten Tarifermittlung und einem anschliessendem (nationalen) Benchmarking. Herausgestrichen wurde das Erfordernis einer guten Kostentransparenz. Denn die ungenügende Transparenz der vom Kanton Luzern für das Benchmarking herangezogenen Referenzspitäler war einer der Hauptgründe für die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses durch das BVGer.
Dennoch bleiben Fragen offen. Das Gericht hat eben keinen Preis fixiert, sondern den Fall an die Luzerner Regierung zurückgewiesen. Die Kantone, die als Spitaleigner und erste Entscheidungsinstanz bei strittigen OKP-Spitaltarifen eine problematische Doppelrolle einnehmen, werden vom vorliegenden Entscheid in die Verantwortung genommen - insbesondere betreffend Ausgestaltung des Benchmarkings.
Auf dem Spiel steht dabei nicht weniger als die Bezahlbarkeit unserer Krankenkassenprämien. So plädiere ich für ein strenges Benchmarking, was bedeutet ein vergleichsweise günstiges Spital mit guter Qualität ist die Referenz. Die Spitalträger hingegen präferieren eine milde Variante, bei der ein Spital als Referenz gewählt wird, dass kostenmässig über dem Durchschnitt liegt. Die Differenz zwischen diesen Varianten beträgt rund eine halbe Milliarde Franken pro Jahr zulasten der Grundversicherung. Das ist Geld von uns Prämienzahlerinnen und Prämienzahlern. Ich werde deshalb weiterhin Einfluss auf die Tarifgestaltung nehmen.
Meine seit 2012 intensivierte Empfehlungstätigkeit bei stationären Spitaltarifen zeigt bereits Wirkung: So haben sich vor kurzem die beiden Universitätsspitäler Genf und Lausanne mit den Versicherern auf eine rund 1000 Franken tiefere Baserate 2012 geeinigt, als sie ursprünglich beantragten (rund Fr. 10‘400.- statt Fr. 11‘400.-).
Im Interesse der Prämienzahlenden – und einer Kostenkontrolle im Gesundheitswesen: Wir bleiben am Ball. Damit es nicht heisst: Koste es, was es wolle – sondern koste es, was es solle!
Bildquelle: MS Office, Cliparts
 Was machen Sie, wenn Sie sich zwischen zwei gleich guten Medikamenten, von denen das eine teurer als das anderer ist, wählen können? Ich nehme an, Sie machen es wie ich und wählen das günstigere. Ihre Krankenkassenprämie dankt es Ihnen sicher. Dass wir leider nicht immer die Wahl haben, zeigt folgender Fall, von dem Anfang März in den Medien zu lesen war.
Was machen Sie, wenn Sie sich zwischen zwei gleich guten Medikamenten, von denen das eine teurer als das anderer ist, wählen können? Ich nehme an, Sie machen es wie ich und wählen das günstigere. Ihre Krankenkassenprämie dankt es Ihnen sicher. Dass wir leider nicht immer die Wahl haben, zeigt folgender Fall, von dem Anfang März in den Medien zu lesen war.
Im Zentrum stehen die beiden Arzneimittel Avastin und Lucentis. Die italienischen Behörden werfen der Zulassungsinhaberin von Avastin (Roche) und derjenigen von Lucentis (Novartis) Absprachen vor. Konkret sollen sie Ärzten bei der Behandlung der Augenkrankheit „feuchte Altersbedingte Makula-Degeneration (AMD)“ vom Einsatz von Avastin abgeraten und das extrem viel teurere Lucentis empfohlen haben. In den Industriestaaten ist AMD Hauptursache für eine Erblindung bei Menschen im Alter von über 50 Jahren. Novartis und Roche wurden wegen regelwidrigen Absprachen vom italienischen Kartellamt zu einem Bussgeld von jeweils rund 90 Millionen Euro verurteilt.
Avastin ist in der Schweiz nur als Krebsmedikament zugelassen und - im Gegensatz zu Lucentis - nicht für die Behandlung von AMD. Die beiden Medikamente sind jedoch sehr ähnlich, denn der Wirkstoff von Avastin bildete die Grundlage für die Entwicklung von Lucentis. Der einzige grosse Unterschied ist der Preis. Zurzeit laufen mehrere Studien, welche die Wirksamkeit von Lucentis und Avastin vergleichen. Ein erstes Ergebnis hat gezeigt, dass die Wirkung bei der Behandlung von AMD vergleichbar ist. Setzt ein Arzt aber Avastin gegen AMD ein, haftet nicht die Zulassungsinhaberin Roche, sondern der behandelnde Arzt, weil Avastin nicht für AMD zugelassen ist. Kostenbewusste Ärzte gehen also ein gewisses Risiko ein und werden für das Kosten sparen bestraft!
Als Zulassungsinhaberin von Avastin könnte Roche das relativ einfach ändern. Denn kassenpflichtige Medikamente stehen auf der Spezialitätenliste. Um in diese Liste aufgenommen zu werden, können Pharmafirmen einen Antrag stellen. Im Falle von Avastin müsste Roche lediglich eine Indikationserweiterung beantragen, da es bereits für verschiedene Krebserkrankungen zugelassen ist. Roche tut dies aber nicht.
Ich fordere seit Jahren, dass auch Krankenversicherer ein Antrags- und Rekursrecht bei allen Entscheiden im Zusammenhang mit der Spezialitätenliste erhalten. Leider ist dies bis heute nicht der Fall. Momentan sind zwei Motionen (13.3956 und 13.3973) hängig, die meine Forderung unterstützen. Es ist zu hoffen, dass sich das Parlament für eine solche Regelung entscheidet. Damit unsere Krankenkassenprämien nicht weiter explodieren.
Heutigen Presseberichten (NZZ, 10.4.2014) zufolge, ermittelt nun auch Frankreich in gleicher Sache wegen einem möglichen Verstoss gegen das Wettbewerbsrecht. Ich hoffe, dass diese neuerliche Untersuchung nun endgültig die Einsicht in die Notwendigkeit wachsen lässt und Roche den längst überfälligen Antrag auf Indikationserweiterung schnellstmöglich stellt.
Bildquelle: MS Office, Cliparts
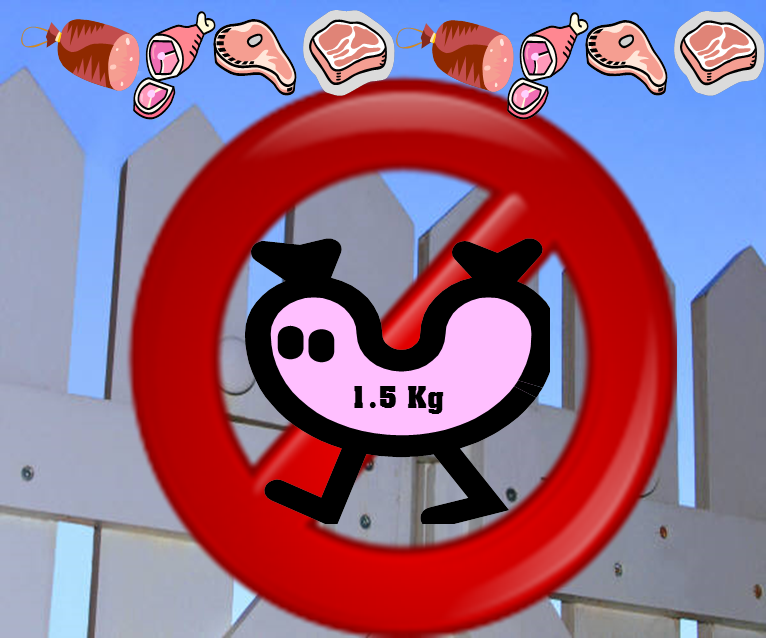 Ab Juli 2014 gelten neue Zollbestimmungen für die Einfuhr von Fleisch, das teilte der Bundesrat kürzlich im Rahmen der Änderung der Verordnung über die Veranlagung von Waren im Reiseverkehr mit.
Ab Juli 2014 gelten neue Zollbestimmungen für die Einfuhr von Fleisch, das teilte der Bundesrat kürzlich im Rahmen der Änderung der Verordnung über die Veranlagung von Waren im Reiseverkehr mit.
Statt wie bisher ein halbes Kilogramm Frischfleisch (Ausnahme: Geflügelfleisch) und 3.5 kg gesalzenes bzw. mariniertes Fleisch (oder eben frisches Geflügelfleisch), sollen ab Juli generell nur noch ein Kilogramm Fleisch jedweder Art pro Person und Tag eingeführt werden dürfen.
Der Bundesrat führt ins Feld, dass es mit der neuen Regelung mehr Rechtssicherheit gäbe und der zunehmende Reiseverkehr effizienter bewältigt werden könne.
Das ist ohne Zweifel richtig, aber es ist nur die halbe Geschichte.
Tatsache ist nämlich auch, dass hier die Schotten in Sachen Fleischeinfuhr in beträchtlichen Ausmass dichter gemacht werden. Statt gesamthaft 4 kg diverser Fleischarten wird man neu nur noch 1 kg Fleische pro Tag und Person zollfrei einführen können. Das ist eine Reduktion um 75 Prozent.
Die mutmasslichen Nutzniesser dieser „Vereinfachung“ sind die Schweizer Tiermäster und Metzger. Denn der so deutlich eingeschränkte Wettbewerb mit ausländischen Produkten, nimmt den Preisdruck vom einheimischen Gewerbe. Zum Nachteil der inländischen Kunden. Rechtsicherheit und Effizienz sind ganz sicher wichtige Kriterien bei Einfuhrbestimmungen. Sie sind jedoch keine einleuchtende Erklärung dafür, warum man die Mengen in diesem Ausmass beschränkt. Der Spielraum für den Wettbewerb mit ausländischen Fleischprodukten wird so zukünftig kleiner - ein Bärendienst an der Schleifung der Hochpreisinsel.
Bevormundung und Marktabschottung sind keine dauerhaft tragfähigen Lösungen. Wer die Konsumentinnen und Konsumenten einsperrt, traut ihnen keinen eigenständigen Entscheid zu. Die stärkste Vereinfachung wäre zweifellos die völlige Abschaffung aller Kontingente. Warum fassen wir das nicht ins Auge und lassen den liberalen Wettbewerb spielen? Stattdessen wird die neue Regelung dazu führen, dass mangels Kenntnissen über die Regelung zahlreiche unbescholtene Bürger in Zukunft beim Grenzübertritt zu Schmugglern werden, weil sie in Italien eine grosse Salami oder im Schwarzwald einen Speck als Souvenir gekauft haben.
Bildquelle: MS Office, Cliparts