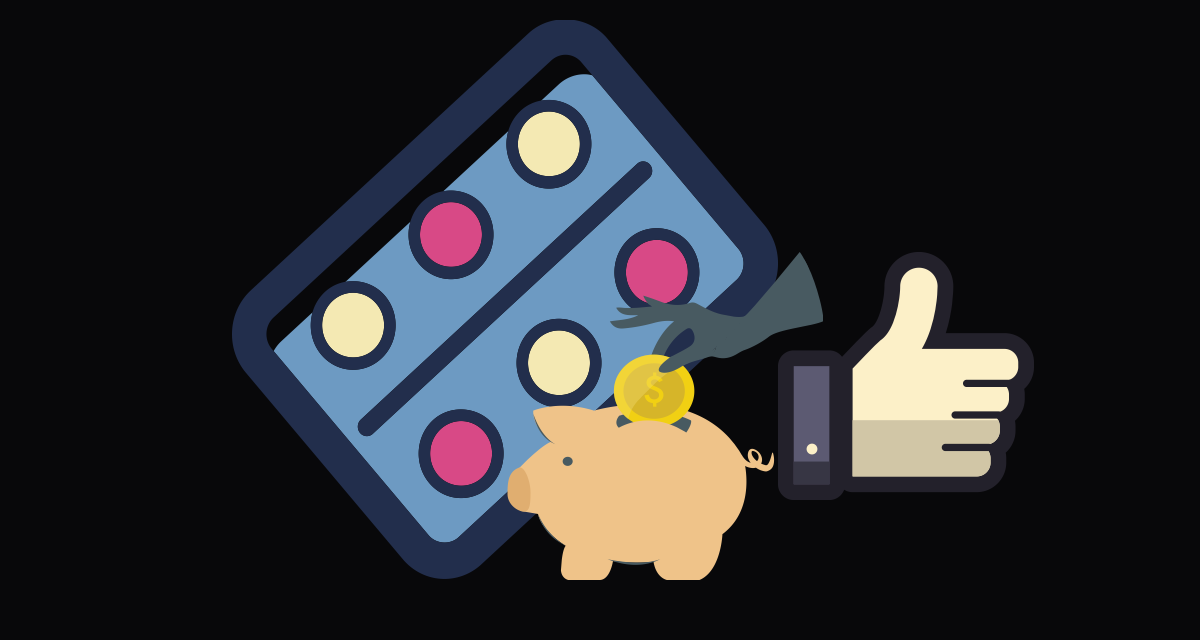 Es ist wirklich alte News, dass viele Medikamente in unseren Nachbarländern günstiger sind als bei uns. Das gilt für Originalmedikamente und noch viel mehr für Generika. Oftmals heisst es: Gleicher Name, gleiche Packung – deutlich verschiedener Preis.
Es ist wirklich alte News, dass viele Medikamente in unseren Nachbarländern günstiger sind als bei uns. Das gilt für Originalmedikamente und noch viel mehr für Generika. Oftmals heisst es: Gleicher Name, gleiche Packung – deutlich verschiedener Preis.
Ich habe es – in anderen Zusammenhängen - schon oft gesagt - und wiederhole mich gern: Medikamente sind sehr gut handelbare Güter. Wie gut, zeigen die Käufe im grenznahen Ausland oder die Umsätze von Versandapotheken.
Viele Schweizer Patienten - mutmasslich kostenbewusste und/ oder mit einer hohen Franchise - beziehen ihre Medikamente in den Nachbarländern. Viele werden dabei von ihren Krankenkassen unterstützt, indem die Kosten für die Medikamente übernommen werden. (Immer vorausgesetzt, man hat ein Rezept, das Medikament ist kassenpflichtig und der Preis ist tiefer als bei uns.) Leider entspricht diese Praxis, so löblich sie ist, nicht den Buchstaben des Gesetzes. Deshalb verwundert es wenig, dass einige Krankenkassen genau dies ins Feld führen, um eben nicht zu zahlen.
Diese ungelöste Situation ist kein Zustand – da bin ich einer Meinung mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG). Deshalb begrüsse ich es ausdrücklich, dass das BAG nun das Gespräch mit den Krankenkassen sucht. Denn es gilt diese Win-Win-Situation für Krankenkassen und Prämienzahler in Gesetzesbuchstaben umzusetzen. Denn es kann nicht sein, dass mit jährlichem Bedauern neue Prämienanstiege verkündet werden, aber alle, die diesen Zustand ändern wollen, das nur mit Rechtsunsicherheit tun können. Im Gegenteil, wir sollten den globalen Wettbewerb nutzen und fördern!
All jenen, die nun befürchten, die Pharma-Industrie würde die Forschung einstellen, sei gesagt: In Frankreich, Deutschland und Italien macht die Pharma-Industrie auch noch reichlich Gewinne und das bei z.T. sehr viel tieferen Preisen. Es gibt keinen Grund, warum die kleine Schweiz dermassen überproportional zu den Konzerngewinnen beitragen sollte.
Mein Fazit: Die Kosten für die Medikamente müssen sinken. Die Bürger haben das verstanden und sie haben begonnen, Lösungen dafür zu finden. Hier ist der Bürger offensichtlich kreativer und schneller als der Staat. Ein lautes Bravo an unsere Mitbürger und die dringende Aufforderung an die Verantwortlichen, den Gesetzestext den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Seit Ende der 80er wissen wir: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – Es wäre schade, wenn wir das am eigenen Leib erfahren müssten.
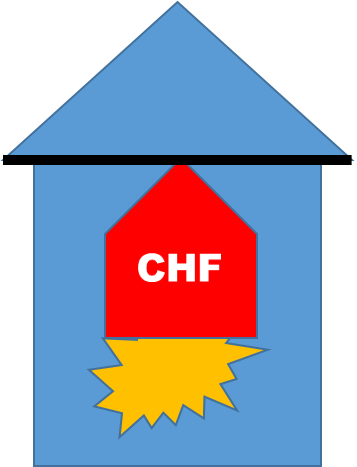 Es ist tatsächlich so, dass einige Unternehmen bei der Wettbewerbskommission (WEKO) nachgefragt haben, ob es mit unseren Gesetzen im Einklang wäre, wenn sie Höchstpreise für die Schweiz festgelegen würden und zwar, um sicherzustellen, dass die Schweizer nicht über den Tisch gezogen werden und das ihnen Währungsvorteile durch den stärkeren Franken auch tatsächlich weitergegeben werden.
Es ist tatsächlich so, dass einige Unternehmen bei der Wettbewerbskommission (WEKO) nachgefragt haben, ob es mit unseren Gesetzen im Einklang wäre, wenn sie Höchstpreise für die Schweiz festgelegen würden und zwar, um sicherzustellen, dass die Schweizer nicht über den Tisch gezogen werden und das ihnen Währungsvorteile durch den stärkeren Franken auch tatsächlich weitergegeben werden.
An dieser Anfrage sind zwei Dinge bemerkenswert: Erstens, die hiesigen Konsumentenbedürfnisse werden zunehmend auch von Konsumgüter-Unternehmen zur Kenntnis genommen und zweitens, die Hersteller sind offenbar der Meinung, dass die Preisgestaltung der Schweizer Händler nicht immer angemessen ist.
Die WEKO hat klargestellt, dass Höchstpreise solange in Ordnung sind (sie fallen nicht unter Artikel 5 Absatz 4 des Kartellgesetzes), wie sie den Preiswettbewerb nicht beeinträchtigen. Das heisst, solange die Händler frei sind und (es auch bleiben!) irgendeinen Preis unterhalb der Höchstgrenze festzulegen, gibt es keine Beanstandungen.
Die Botschaft ist klar. Das Bewusstsein wächst, dass man Schweizer Konsumenten nicht über die Gebühr strapazieren darf. Denn diese sind zwar geduldig aber sie reagieren schlussendlich eben doch, und zwar mit Macht.
Ich freue mich über Höchstpreise, die sicherstellen, dass Schweizer Konsumenten Währungsvorteile erhalten – aber nicht über solche, die gleichsam zu undercover-Einheitspreisen werden.
 Seit dem Frühjahr diesen Jahres bietet die französische Staatsbahn TGV-Verbindungen zwischen mehreren grossen Städten zu Billig-Preisen an. Das Vorbild sind ganz offensichtlich Billig-Flieger. Wie bei ihnen auch, werden Tickets zu Tiefstpreisen (ab 10 EUR) verkauft. Getreu dem Motto: Transport von A nach B im Doppelstockwagen ohne Komfort und mit wenig Service. So befinden sich die angefahrenen Bahnhöfe ausserhalb der grossen Städte, Buchungen sind nur übers Internet möglich, eine erste Klasse gibt es nicht, die Gepäckstücke sind limitiert, der Zeitaufwand ist grösser, die Zugbegleitung auf ein Minimum reduziert – ABER der Preis ist unschlagbar.
Seit dem Frühjahr diesen Jahres bietet die französische Staatsbahn TGV-Verbindungen zwischen mehreren grossen Städten zu Billig-Preisen an. Das Vorbild sind ganz offensichtlich Billig-Flieger. Wie bei ihnen auch, werden Tickets zu Tiefstpreisen (ab 10 EUR) verkauft. Getreu dem Motto: Transport von A nach B im Doppelstockwagen ohne Komfort und mit wenig Service. So befinden sich die angefahrenen Bahnhöfe ausserhalb der grossen Städte, Buchungen sind nur übers Internet möglich, eine erste Klasse gibt es nicht, die Gepäckstücke sind limitiert, der Zeitaufwand ist grösser, die Zugbegleitung auf ein Minimum reduziert – ABER der Preis ist unschlagbar.
Das Konzept könnte aufgehen, denn es scheint den Zeitgeist zu treffen. Das Beispiel der Billig-Flieger zeigt: Viele Leute suchen heute eher nach günstigen Transport statt nach dem Reiseerlebnis auf dem Weg zum Zielort.
Eine bedenkenswerte Entwicklung – auch in der Schweiz. Zumal der Druck, Kunden zu finden und zu binden, auch für die SBB grösser werden wird. Denn neben Billigfliegern werden künftig hoffentlich auch Fernbus-Unternehmen Reisende umwerben. (vgl. mein Blog „Fernbusse“)
Die SBB hat soeben mitgeteilt, ihre ICN-Flotte rundum erneuern zu wollen. Neben technischen Revisionen, sollen auch optische Aufwertungen im grossen Stil vorgenommen werden. So ist von neuen Teppichen, neuen Sitzbezügen und verbesserten Handyempfang die Rede. Das ist natürlich nicht gratis und der Kunde bezahlt es via Ticketpreis.
Ich stelle mir die Frage, ob diese Aufwertungen in jedem Fall einem Kundenbedürfnis entsprechen? Oder, ob man statt mit „Klasse“ eben auch mit „Masse“ Kunden gut bedienen kann? Gerade für jüngere Leute und Familien wäre ein solches Konzept überlegenswert. Angesichts stetig steigender Abo- und Ticketpreise im Schienenverkehr (vgl. Newsletter 03/13) wären Konzepte für kleine Budgets eine durchaus sinnvolle Ergänzung des Bahnangebots.
Bildquelle: MS Office, Cliparts
Interessante Informationen kamen heute vom Hauptsitz der Post – zur Freude der Wirtschaft: Die Post verzichtet auf die Einführung eines Rücksendeportos bei Geschäftsretouren. Was ist geschehen? Die Schweizerische Post unterbreitete dem UVEK Anfang Oktober 2010 verschiedene Tarifmassnahmen im sog. reservierten Bereich zur Genehmigung. Unter Anderem plante die Post per 1. April 2011 die Einführung eines Portos für Rücksendungen von Geschäftsbriefen, die wegen ungültiger Adresse nicht zugestellt werden können. Die Post begründete diese Massnahme mit erheblichen Kosten, die mit der Rücksendung dieser Briefe verbunden seien.
Gemäss Gesetz habe ich mich zu Handen des UVEK zu dieser vorgesehenen Massnahme geäussert. In meiner formellen Empfehlung wies ich das UVEK darauf hin, dass diese Tarifmassnahme einen Bereich betreffen würde, in dem die Post gemäss einer umfassenden Analyse der Preisüberwachung auch ohne Retourporto gute Gewinne erwirtschaftet. Wenn tatsächlich ein Rücksendeporto eingeführt würde, so dürfte dies nur geschehen, wenn gleichzeitig die heute gültigen Preise für die Zustellung der Sendungen gesenkt werden. Da dies nicht vorgesehen war, empfahl ich die Ablehnung des Gesuchs. Resultat: Die Post hat in der Folge ihr Tarifbegehren zurück gezogen. Für die Kunden bedeutet dies eine Entlastung um mehr als 10 Millionen Franken pro Jahr.
Gemäss Internetauftritt der Post plant diese nun aber einen neuen Vorstoss für die Einführung eines Rücksendeportos. Diese Massnahme soll per Anfang Juli 2011 in Kraft treten. Die Preisüberwachung wird sich auch zu diesem Vorstoss vernehmen lassen. Donc: Affaire à suivre!
 Heute hat der Bundesrat eine erste Version der sog. SwissDRG-Tarifstruktur genehmigt, mit welcher die Schweizer Akutspitäler ab 2012 ihre stationären Behandlungen abrechnen werden. Bei der Tarifgenehmigung hat der Bundesrat mehrere Auflagen an die Tarifpartner (Spitäler und Krankenversicherer) erlassen mit dem Zweck, die Qualität der Tarifstruktur und die Behandlungsqualität der Spitäler zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass der neue gesamtschweizerische Spitaltarif als solcher keine Mehrkosten zulasten der sozialen Krankenversicherung generiert. Dabei hat sich der Bundesrat stark auf eine Empfehlung des Preisüberwachers vom 12. April 2010 zum SwissDRG-Tarifvertrag abgestützt.
Heute hat der Bundesrat eine erste Version der sog. SwissDRG-Tarifstruktur genehmigt, mit welcher die Schweizer Akutspitäler ab 2012 ihre stationären Behandlungen abrechnen werden. Bei der Tarifgenehmigung hat der Bundesrat mehrere Auflagen an die Tarifpartner (Spitäler und Krankenversicherer) erlassen mit dem Zweck, die Qualität der Tarifstruktur und die Behandlungsqualität der Spitäler zu gewährleisten und gleichzeitig sicherzustellen, dass der neue gesamtschweizerische Spitaltarif als solcher keine Mehrkosten zulasten der sozialen Krankenversicherung generiert. Dabei hat sich der Bundesrat stark auf eine Empfehlung des Preisüberwachers vom 12. April 2010 zum SwissDRG-Tarifvertrag abgestützt.
Ab 2012 werden damit alle stationären Spitalbehandlungen aufgrund ihrer zugrundeliegenden Diagnosen in eine von gut 1000 Fallgruppen eingeteilt, welche je ein unterschiedliches Kostengewicht aufweisen. So weist z.B. in der heute genehmigten Tarifversion eine stationäre Behandlung von Kopfschmerzen ein Kostengewicht von 0.615 auf und die Implantation einer Bandscheibenprothese ein solches von 2.654. In den kantonalen Tarifverhandlungen zwischen Kassen und Spitälern müssen jedoch in Zukunft nur die Preise für ein Kostengewicht von 1.0 ausgehandelt werden – die sogenannten Baserates ( z.B. Fr. 4000.-). Daraus lassen sich sodann die Entschädigungen aller gut 1000 Behandlungs-Fallgruppen direkt ableiten. Die Behandlung von Kopfschmerzen würde somit die Krankenkassen auf Fr. 2460.- (Fr. 4000.- x 0.615) zu stehen kommen und die Implantation einer neuen Bandscheibenprothese auf Fr. 10‘616.- (Fr. 4000.- x 2.654). Die Preisüberwachung wird ab 2011 Tarifempfehlungen an die Kantonsregierungen zu den kantonalen Baserates abgeben und sich dabei an den günstigen Baserates orientieren.
Die Einführung der neuen, verursachergerechten Spitaltarife ist somit auf Kurs. Was ist Ihre Meinung?
SwissDRG Tarifempfehlung an den BR
 Der Bundesrat hat entschieden: Ab dem 1. Juli 2010 gilt in der Schweiz das sogenannte Cassis-De-Dijon-Prinzip. Ich habe bereits früher einmal darüber gebloggt; erfreulich ist, dass es nun ab 1. Juli diesen Jahres so weit sein wird.
Der Bundesrat hat entschieden: Ab dem 1. Juli 2010 gilt in der Schweiz das sogenannte Cassis-De-Dijon-Prinzip. Ich habe bereits früher einmal darüber gebloggt; erfreulich ist, dass es nun ab 1. Juli diesen Jahres so weit sein wird.
Die Beseitigung technischer Handelshemmnisse erleichtert die Vermarktung von Importprodukten - jene Kategorie von Produkten, die in der Schweiz traditionell mehr kosten als im Ausland. Allerdings ist die Liste der Ausnahmen doch recht lange - vor übertriebenen Erwartungen muss man deshalb warnen. Namentlich bei Lebensmitteln, Kosmetika, Textilien und Velos ergibt sich nun ein Preissenkungspotential.
Neben Cassis-De-Dijon ist der Euro so günstig wie noch nie. Der starke Schweizer Franken führt dazu, dass Importeure - sofern in Euro abgerechnet wird - für Importwaren weniger zahlen müssen. Herrscht wirksamer Wettbewerb, muss dieser Währungsvorteil über kurz oder lang auch im Portemonnaie von Herrn und Frau Schweizer zu spüren sein.
Importeuer oder Importeur?
Konsumentenfreundliche Importeure - oder solche, die von der Konkurrenz nicht ausgebootet werden wollen - tun gut daran, Währungsvorteile an die Kundinnen und Kunden weiter zu geben. Jene, die nur ihre Marge vergrössern wollen, werden aufgrund des Wettbewerbsdrucks, mit tieferen Marktanteilen aufgrund aufmerksamer Kundinnen und Kunden dafür bezahlen. Das seco wird die Auswirkungen der Gesetzesnovelle monitoren.
Auch wir als Konsumenten können hier unsere Rolle spielen: Indem wir den Markt nutzen, vergleichen - und namentlich bei teureren Importgütern vor dem Kaufentscheid den Verkäufer auf Wechselkursvorteile hinweisen und deren Weitergabe verlangen. Oder - wenn die Differenz zu gross oder der Verkäufer nicht verhandlungsbereit ist - halt wohl oder übel im Ausland einkaufen.
Bildquelle: Wikipedia, Neon ja.
+flickr%2c+Jens+Dahlin.jpg) Anfangs Woche habe ich mich ganz speziell gefreut, als ich auf einen Artikel der „Zentralschweiz am Sonntag“ gestossen bin. Unter dem Titel „Parallelimporte lassen Preise purzeln“ hat der Journalist Stefan Kyora die Preisbewegungen ausgewählter Produkte nach der Aufhebung des Parallelimport-Verbots analysiert. In seinen Beobachtungen kommt er zum Schluss, dass die Preise mit zunehmenden Parallelimporten sinken.
Anfangs Woche habe ich mich ganz speziell gefreut, als ich auf einen Artikel der „Zentralschweiz am Sonntag“ gestossen bin. Unter dem Titel „Parallelimporte lassen Preise purzeln“ hat der Journalist Stefan Kyora die Preisbewegungen ausgewählter Produkte nach der Aufhebung des Parallelimport-Verbots analysiert. In seinen Beobachtungen kommt er zum Schluss, dass die Preise mit zunehmenden Parallelimporten sinken.
So berichtet Kyora zum Beispiel über einen findigen Zuger Unternehmer, der bereits seit einiger Zeit Gillette-Produkte aus aller Welt in die Schweiz importiert. Dank dieser Einkaufsstrategie könnten sich die Schweizer Kunden unter dem sonst herrschenden Preisniveau mit diesen Markenartikeln eindecken. Nicht nur Hygieneartikel, sondern auch Bekleidung, Wohnbedarf oder Parfüms würden vermehrt nicht mehr auf dem Weg des jeweiligen Generalimporteurs beschafft, sondern bei anderen ausländischen Anbietern zu vorteilhafteren Konditionen geordert; so gäbe es unter anderem auch einzelne Autohändler, die ihre Neuwagen direkt im Ausland beschaffen würden – und diese so um einiges günstiger weiterverkaufen könnten.
Die Markenartikelhersteller mögen dieses Einkaufsverhalten nicht goutieren, müssen es jedoch zähneknirschend hinnehmen. Seit letzten Sommer das Importverbot für patentgeschützte Produkte aus dem europäischen Wirtschaftsraum aufgehoben wurde, bröckelt die Hochpreisinsel Schweiz; zwar noch etwas zaghaft und langsam, dafür aber stetig. Es zeichnet sich zunehmend ab, dass die Schweizer Kunden Preisdiskriminierungen gegenüber dem benachbarten Ausland gerade bei Artikeln des täglichen Gebrauchs immer weniger tolerieren und dass sich die Anbieter andere Einkaufskanäle mit günstigeren Konditionen suchen (müssen), um konkurrenzfähige Preise bieten zu können.
In diesem Sinne: Eine Schwalbe macht zwar noch keinen Sommer, es bleibt aber zu hoffen, dass sich dieser Trend zum vermehrten Parallelimport weiterhin fortsetzt; nicht zuletzt weil die Preisdiskrepanzen gegenüber unseren Nachbarländern meines Erachtens kaum gerechtfertigt werden können.
Foto: Flickr, Jens Dahlin